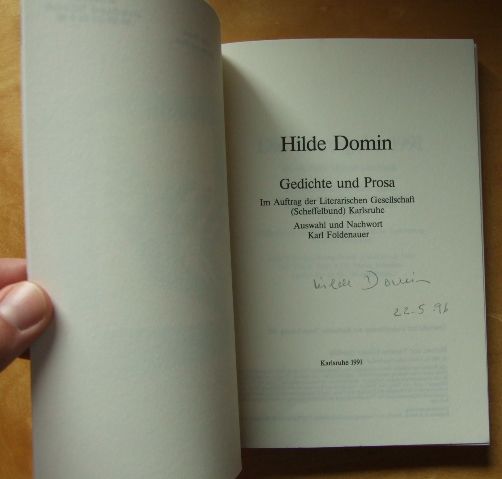"Na, warst du heute wieder ein Kavalier?"
Es würde mich interessieren, wie viele Schach spielende Männer irgendwann einmal diesen Spruch von Vereinskameraden hören durften, nachdem sie gegen eine Frau verloren hatten. Ich nehme an, es sind nicht wenige.
Meistens bleibt's bei so einem Spruch; es wird nicht noch nachgebohrt (wenn, dann tatsächlich schachlich-sachlich). Und weil Schach den Charakter stärkt, richtet das auch keinen größeren Schaden in der männlichen Psyche an, meine ich. Ärger potenziert sich in der Regel angesichts der Art und Weise einer Niederlage - sprich: der eigenen Dummheit, nicht angesichts des Geschlechts des Gegners.
Und dennoch, in diesem harmlosen Flachs unter Männern schwingt das alte Vorurteil mit: Frauen können eigentlich nicht Schach spielen, jedenfalls nicht so gut wie Männer. Oder wenigstens sind sie nicht zu Spitzenleistungen fähig. Wenn eine Frau gewinnt, dann hat sie der Mann höflicherweise gewinnen lassen.
Michail Botwinnik führte die schachliche Schwäche der Frauen auf Organisches zurück (
pdf-Quelle). Zwar sei "der Umfang des Nervensystems ... bei Männern und Frauen gleich, aber ein bedeutender Teil wird für den Steuermechanismus des Organismus gebraucht. Und da wirkt es sich aus, dass der Organismus der Frauen komplizierter ist, vor allem deshalb, weil die Frauen Kinder zur Welt bringen. Da bleiben im Nervensystem der Frauen weniger Ressourcen für das Treffen von Entscheidungen.“
"Frauen können nicht fünf Stunden lang still sitzen", war
Garri Kasparows einfache Erklärung, die
er begründete: "Das liegt alles an den Unvollkommenheiten der weiblichen Psyche. Keine Frau kann einen längeren Kampf durchhalten. Sie kämpft gegen die Gewohnheit von Jahrhunderten und Jahrhunderten, seit Anbeginn der Welt." Eher könne ein Computer gegen ihn gewinnen als eine Frau. Ähnlich überzeugt gab sich seinerzeit schon
Bobby Fischer: „Ich kann jeder Frau einen Springer vorgeben, und ich werde immer noch gewinnen." Aber was sein Verhältnis zu Frauen ganz allgemein betrifft,
war Fischer ohnehin der Ansicht: "Schach ist besser."
Judit Polgár war die erste Frau, die den Großmeistertitel der Männer erringen konnte: GM, nicht "nur" WGM. Nach wie vor ist sie die Nummer 1 der
Frauenweltrangliste und die einzige Frau in den
Gesamt-Top 100. Einzig die Chinesin
Hou Yifan kommt ihr allmählich auf die Fersen. 2009 unterlag Polgár erstmals einer Frau:
Alexandra Kosteniuk, zu diesem Zeitpunkt Frauen-Weltmeisterin (ein Titel, um den sich Polgár nie bemüht hat), konnte
eine Blitzpartie gegen sie gewinnen.
In einem
Interview mit der TAZ 2002 erzählte Judit Polgár, wie es so ist, als einzige Frau in Männerturnieren zu bestehen. Mit welchen "unmöglichen Spitzen" sie zu tun hat(te), lässt sie im Unkonkreten, aber man kann es sich ausmalen. Und sie bestätigt, dass ihrer Meinung nach Männer Probleme damit haben, gegen Frauen anzutreten - aufgrund des "psychischen Drucks" der Mannschaftskameraden.
Längst ist nachgewiesen, dass es nicht mit einer grundsätzlichen Überlegenheit im logischen Denken zu tun hat, dass es mehr Spitzenschachspieler als -spielerinnen gibt. Vielmehr ist es ein schlichter statistischer Effekt: dass nämlich
"die Unterlegenheit der Frauen nahezu exakt dem entspricht, was rechnerisch zu erwarten wäre angesichts des Frauenanteils unter den Schachspielern insgesamt". Aus einer größeren Basisgruppe gehen mit größerer Wahrscheinlichkeit größere Leistungen hervor. Eigentlich sollte an seinem eigenen logischen Denken zweifeln, wer daran nicht schon früher gedacht hat. Und das, obwohl
Schach doch intelligenter macht.
Woran aber liegt es, dass es immer noch deutlich weniger Schachfrauen als Schachmänner gibt? Spontan fällt mir ein:
- Traditionell galt das Schachspiel nicht als angemessene Beschäftigung für Mädchen. Darum bekamen (bekommen?) es eher die Söhne beigebracht als die Töchter.
- Generell finden weniger Mädchen dauerhaft Gefallen an diesem "abstrakten" und "zweckfreien" Spiel als Jungen. Auch hier dürfte der Grund eher in der Erziehung und den gesellschaftlich vermittelten Rollenvorstellungen zu suchen sein als in biologischen Voraussetzungen.
- Ich vermute, verstärkend dürfte gewirkt haben (und noch wirken?), dass mehr Sponsoren- und Preisgelder für die Männerturniere fließen. Die besten Frauen können nicht vom Schach leben, im Gegensatz zu den besten Männern. In der Konsequenz muss es in der ohnehin kleineren Gruppe auch unter den Besten deutlich weniger Motivation geben, ausschließlich die Schachkarriere aufzubauen.
- Weitere Gründe?
Und natürlich, ein Detail nebenbei: Großes Aufhebens macht die Schachmännerwelt immer dann, wenn eine Frau nicht nur gut Schach spielt, sondern dazu auch noch gut aussieht. Das verlangt ja gleich doppelte Hirnakrobatik: Frau vs. Schach und Schönheit vs. Intelligenz. Die bereits genannte Alexandra Kosteniuk
wirbt gerne als Fotomodell fürs Schach. Und wie lautet dann beispielsweise der
erste Satz in einem Bericht über ihr Abschneiden bei der Blitzschach-WM 2009? "Schöne Frauen verführen Schachspieler zu riskantem Spiel." Immerhin liegt dem
eine Studie zugrunde. Das überschießende Testosteron lässt uns also sogar auf dem Schachbrett den Prahlhans geben. Was will Mann machen.
Ich jedenfalls habe beim Schachspielen nie im Sinn, "Kavalier" zu sein. Ich will gewinnen, ganz gleich, ob gegen Männer oder Frauen. Und wenn ich verliere, dann war mein Gegenüber eben besser. Ende Gelände.
Nein, nicht ganz. Natürlich entstand dieser Artikel vor dem Hintergrund der aktuellen Sexismus-Debatte, und neben dem
heutigen Blogeintrag von Mechthild Werner in unserem evkirchepfalz-Blog erlaube ich mir an dieser Stelle, auf lesenswerte Diskussionsbeiträge von Männern hinzuweisen:
Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach
-
Brüderle ist doch super
-
Derailing und die Lämmerfrage
Anatol Stefanowitsch:
-
Sagt ihnen nicht, dass sie sich hätten wehren sollen
Matthias Jung:
-
Aufschrei zwischen allgegenwärtigem Sex und alltäglichem Sexismus
Und Wolfgangs Handlungskonsequenzen für Männer aus dem erstgenannten Artikel zitiere ich hier einfach mal. Sie wären ein Anfang - und eine erste Antwort auf Mechthilds Frage: "Was bleibt zu tun?"
- "Herrenwitze" nicht lustig finden. Und das auch sagen. Ich mache eher gute Erfahrungen damit, irritiert zu sein, wenn in reinen Männerrunden Sexismus um sich greift. Dass das nachlässt, wenn ich dabei bin, verbirgt ihn zwar nur - aber jede der Minuten, in denen sich Männer wie Menschen benehmen, ist eine gute Minute.
- Übergriffiges Verhalten benennen. Schwierig, wenn es jemand in der Hierarchie über dir ist, aber notwendig, denke ich. Ein Netzwerk aus Männern innerhalb von Unternehmen und Parteien und Organisationen und so zu gründen, das sich gegenseitig stützt, wenn jemand eingreift, kann dann helfen. Und der eigentliche Skandal im Brüderle-Fall ist doch, dass keiner der Kollegen eingriff, als der wandelnde Herrenwitz ihre Kollegin angriff.
- Die Sprache ändern. Denn meine Erfahrung ist, dass allein die Tatsache, dass ich mir die Zeit nehme, in Gesprächen, Meetings, Präsentationen inklusive Sprache zu verwenden, und das, egal, wie die Gruppe zusammen gesetzt ist, das Verhalten sogar der Männer ändert, die eigentlich und innerlich Brüderle einen tollen Hecht finden.
- Grenzen ziehen, auch wo es weh tut.