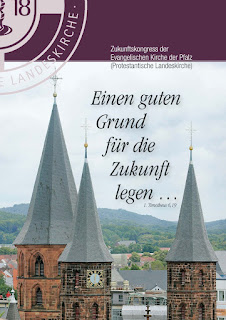|
| Leider schüttete es drei Tage lang fast ununterbrochen - ansonsten hätten Sessions im Freien reizen können. |
Posts mit dem Label *Zukunft der Kirche werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label *Zukunft der Kirche werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Sonntag, 2. Juni 2013
Erwartungskollisionen. Das Barcamp Kirche 2.0 in Tutzing
2. Juni 2013, 15:50 Uhr: Ich sitze im ICE Richtung Mannheim und lasse das Barcamp Kirche 2.0, diesmal ausgerichtet von evangelisch.de in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie Tutzing, Revue passieren. Schauen wir zunächst auf die Rahmenbedingungen:
Die Tagungsorganisation und -leitung, das Ambiente und die Verpflegung, die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, die technische Ausstattung, sprich: das ganze Drumherum ließ kaum Wünsche offen: Großes Lob und vielen Dank!
Freitag, 8. Februar 2013
Twittern im Gottesdienst?
Noch vor wenigen Jahren war ich der Meinung: Handys haben im Gottesdienst nichts zu suchen. Aus Höflichkeit und Respekt und Ehrfurcht und so. Inzwischen hat sich das geändert. Denn inzwischen habe ich Twittergottesdienste erlebt und mitgefeiert.
Donnerstag, 4. Oktober 2012
Kleiner Fischerverein
Es gibt einen Witz, in dem der Papst nach seinem Tod an die Himmelspforte kommt und dort nicht erkannt wird.
"Aber ich bin doch der Papst!"
"Papst, Papst ... nie gehört, was soll das sein?", fragt Petrus.
"Aber ich bin doch dein Nachfolger!", protestiert der Papst.
"Hm, das sollte ich doch wohl wissen", meint Petrus süffisant.
"Ich bin das Oberhaupt der katholischen Kirche!", macht der Papst einen letzten Versuch.
"Kirche, hmm ... einen Moment, ich frag' mal nach."
Petrus bringt das Anliegen vor Jesus; aber der ist auf Anhieb genauso überfragt und greift deshalb zum Telefon. Kurz darauf bricht Jesus in schallendes Lachen aus. Dann sagt er: "Petrus, stell dir vor, der kleine Fischerverein, den wir damals gegründet haben ... den gibt's immer noch!"
Ja, in der Tat, wenn es auch nicht das richtige Wort ist: Den kleinen Verein gibt's immer noch – inzwischen mit unzähligen Ortsvereinen und Regionalverbänden, wenn man so will, mit unterschiedlichen Ausprägungen, auch Streitpunkten, mit schwieriger, ja, oft trauriger und beschämender gemeinsamer und getrennter Geschichte – und doch: in alledem miteinander verbunden durch die eine Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes.
„Wir danken Gott allezeit für euch alle … ihr seid ein Vorbild geworden für alle Gläubigen“ – das schreibt einst der Apostel Paulus an die von ihm erst kurz zuvor gegründete christliche Gemeinde in Thessaloniki. „Wir danken Gott allezeit für euch alle“ – für vielleicht fünfzig Leute, die inmitten einer pulsierenden, multireligiösen Hafenmetropole zum Gottesdienst zusammen kommen und Nächstenliebe üben.
Die christliche Gemeinde ist gegründet auf Hoffnung. Es gibt uns noch, uns, den kleinen Fischerverein, gegründet von Jesus und Petrus vor 2000 Jahren. Knapp fünfzig Millionen in Deutschland, über zwei Milliarden in aller Welt.
Und Gott Vater spricht zu Gott Sohn: „Natürlich gibt’s den noch. Du hast doch damals dem Heiligen Geist gesagt, dass er sich um sie kümmern soll. Und du weißt ja, der ist hartnäckig. Was der einmal angefangen hat, das gibt er so schnell nicht auf, egal, wie schwer sie es ihm machen.“
Und Petrus sagt an der Himmelspforte: “Ist gut, Papst. Komm rein.“
Donnerstag, 13. September 2012
'Es gibt sie immer noch.' - Predigt am 9.9.2012 (14. nach Trinitatis)
[Gastpredigt, gehalten in der Protestantischen Kirche Obrigheim anlässlich der Visitation des Kirchenbezirks Grünstadt
Samstag, 10. März 2012
Portfolio-Analyse: Wort des Jahres in der pfälzischen Landeskirche
Woran denken Sie, wenn Sie das Wort "Portfolio" hören? Für mich hatte das lange Zeit nur mit Aktien zu tun. Ein Investor hat dieses oder jenes Wertpapier in sein Portfolio aufgenommen. Auch Künstler oder Fotografen kamen mir in den Sinn: Ihre repräsentativsten Werke bilden ihr Portfolio, zusammengestellt in Mappen, im Internet, in Foto- und Kunstblogs.
An Kirche habe ich bei "Portfolio" nicht gedacht. Und doch: Die Parlamentarier der pfälzischen Landeskirche, die Männer und Frauen der Synode, machen heute in Kaiserslautern eine "Portfolio-Analyse". Wie Wirtschaftsunternehmen auf ihre Geschäfts-, so blickt die Synode auf alle Handlungsfelder der Kirche. Genauer gesagt: auf sieben große Aufgabengebiete mit insgesamt sechzig (*) Handlungsfeldern. Heute nun wird jeder Synodale jedes dieser Felder bewerten - und für sich die beiden Fragen beantworten: Wie wichtig ist dieses Handlungsfeld generell? Und: Wie profilbildend für die Kirche ist es? Also sozusagen: Wie evangelisch?
Die Mühe soll sich lohnen. Die Analyse soll Antworten liefern auf wichtige Fragen: Wie soll sich die Kirche in Zukunft ausrichten? Woran will sie festhalten - und was einschränken oder aufgeben? Wenn der Kirche weniger Geld zur Verfügung steht, muss sie sich entscheiden – denn nichts ist für eine Kirche lähmender, als sich ständig mit ihrem Geld – also mit sich selbst – zu befassen. Die Kirche braucht ihre Energien und Ideen ja, um für andere da zu sein. Und um Verantwortung in der Gesellschaft wahrzunehmen. Ich hoffe, die pfälzische Kirche sieht nach ihrer Portfolio-Analyse hier klarer.
Die Kirche ist zwar kein Wirtschaftsunternehmen. Doch muss sie sorgfältig damit umgehen, was ihr die Menschen durch Kirchensteuer oder Spenden anvertrauen. Die meisten Menschen lassen sich doch die Kirchensteuer abziehen in dem Bewusstsein, dass die Kirche damit Gutes und Sinnvolles tut.
Geld ist nicht per se gut oder schlecht. Gut oder schlecht ist, was wir damit machen. Fest steht: Das kirchliche Portfolio umfasst auch künftig die großen Arbeitsfelder: Verkündigung, Seelsorge, Bildung, Diakonie, Mission und Ökumene, die Öffentlichkeitsarbeit, und die Organisation, sprich: Verwaltung.
Das alles will bezahlt werden. Und deshalb bleibt auch der Kirche die Sorge um das gute Haushalten nicht erspart.
--
(*) Im RUNDfunk wird gerne mal aufgeRUNDet. Exakt sind es 57 Handlungsfelder.
[Dieser Beitrag lief am 10. März 2012 in SR2 und 3 als "Innehalten".]
An Kirche habe ich bei "Portfolio" nicht gedacht. Und doch: Die Parlamentarier der pfälzischen Landeskirche, die Männer und Frauen der Synode, machen heute in Kaiserslautern eine "Portfolio-Analyse". Wie Wirtschaftsunternehmen auf ihre Geschäfts-, so blickt die Synode auf alle Handlungsfelder der Kirche. Genauer gesagt: auf sieben große Aufgabengebiete mit insgesamt sechzig (*) Handlungsfeldern. Heute nun wird jeder Synodale jedes dieser Felder bewerten - und für sich die beiden Fragen beantworten: Wie wichtig ist dieses Handlungsfeld generell? Und: Wie profilbildend für die Kirche ist es? Also sozusagen: Wie evangelisch?
Die Mühe soll sich lohnen. Die Analyse soll Antworten liefern auf wichtige Fragen: Wie soll sich die Kirche in Zukunft ausrichten? Woran will sie festhalten - und was einschränken oder aufgeben? Wenn der Kirche weniger Geld zur Verfügung steht, muss sie sich entscheiden – denn nichts ist für eine Kirche lähmender, als sich ständig mit ihrem Geld – also mit sich selbst – zu befassen. Die Kirche braucht ihre Energien und Ideen ja, um für andere da zu sein. Und um Verantwortung in der Gesellschaft wahrzunehmen. Ich hoffe, die pfälzische Kirche sieht nach ihrer Portfolio-Analyse hier klarer.
Die Kirche ist zwar kein Wirtschaftsunternehmen. Doch muss sie sorgfältig damit umgehen, was ihr die Menschen durch Kirchensteuer oder Spenden anvertrauen. Die meisten Menschen lassen sich doch die Kirchensteuer abziehen in dem Bewusstsein, dass die Kirche damit Gutes und Sinnvolles tut.
Geld ist nicht per se gut oder schlecht. Gut oder schlecht ist, was wir damit machen. Fest steht: Das kirchliche Portfolio umfasst auch künftig die großen Arbeitsfelder: Verkündigung, Seelsorge, Bildung, Diakonie, Mission und Ökumene, die Öffentlichkeitsarbeit, und die Organisation, sprich: Verwaltung.
Das alles will bezahlt werden. Und deshalb bleibt auch der Kirche die Sorge um das gute Haushalten nicht erspart.
--
(*) Im RUNDfunk wird gerne mal aufgeRUNDet. Exakt sind es 57 Handlungsfelder.
[Dieser Beitrag lief am 10. März 2012 in SR2 und 3 als "Innehalten".]
Samstag, 3. September 2011
Zurück vom Zukunftskongress der pfälzischen Landeskirche ...
... in Kaiserslautern, der von Anfang an die falsche Bezeichnung trug. In seinen ersten Sitzungen schwebte im Vorbereitungskreis immer noch die Absicht im Raum herum, dem Kind einen anderen Namen zu geben. Aber nachdem es provisorisch so getauft und immer bei diesem Namen gerufen worden war, blieb es schließlich dabei. Auf die richtige Bezeichnung kam irgendwie niemand: "Zukunftsmesse" wäre es gewesen. Denn letztlich war es ein "Markt der Möglichkeiten" guter kirchlicher Praxis, aber weder waren Workshops vorgesehen noch Podien, über welche die Gäste hätten in inhaltlich tiefe Diskussionen einsteigen können. Dass dies fehlte, haben mir gegenüber einzelne bemängelt - andere fanden es gerade gut, weil so der Fokus auf der Begegnung, auch dem Kennenlernen anderer kirchlich Aktiver liegen konnte.
Mein Gefühl aus den Gesprächen, die ich geführt habe, und den Rückmeldungen, die ich bekam, ist schon, dass die grundsätzliche Idee aufgegangen ist: dass viele Besucherinnen und Besucher in den verschiedenen Foren gute Anregungen für die eigene Gemeindearbeit gefunden und diese mit nach Hause genommen haben. Klar war es über weite Strecken ein "Klassentreffen" der pfälzisch kirchlich Engagierten, ein Treffen vieler Altbekannter. Und doch kennt man doch bei weitem nicht jede Idee, nicht jedes Projekt, das anderswo umgesetzt wird, schon gar nicht im Detail.
Insgesamt verlief der Zukunftskongress exakt so, wie vom Vorbereitungskreis konzipiert. Aus einer anders zusammengesetzten Steuerungsgruppe wäre ein anderes Konzept erwachsen, aber ich denke, entscheidend ist, sich irgendwann, möglichst zeitig, für ein Konzept zu entscheiden und es dann umzusetzen. Das schließt nicht aus, dass man an der einen oder anderen Stelle doch hätte flexibler agieren können. Aber es folgt ja noch eine Auswertung.
Auch die Aspekte, die Organisatoren nicht in der Hand haben können, stimmten: Die Stadt zeigte sich von ihrer besten Seite, die Sonne strahlte vom Himmel, und "Swingin' Lautern" erzeugte fast Kirchentagsatmosphäre, obwohl die Titelauswahl zwangsläufig nach anderen Kriterien erfolgte ...
Von mir selbst fiel der Druck ab, nachdem die Auftaktveranstaltung in der Fruchthalle vorüber war - und mit den verschiedenen Präsentationen nichts daneben ging, kein Video plötzlich verschwunden, kein Text verschoben, der Beamer nicht von der Hallendecke gestürzt war. Mein Vorhaben, mindestens vier Foren zu besuchen und überall Kurzinterviews zu führen, erwies sich als illusorisch, weil sich sowohl morgens im Forum Bildung und Unterricht als auch nachmittags im Forum Taufe aus den Interviews im Anschluss noch längere Gespräche ergaben. Die wenigen Interviews, die ich geführt habe, werde ich nach und nach auf Posterous einstellen und via Twitter und Facebook zum Anhören verlinken.
Hier noch die Pressemitteilungen aus dem landeskirchlichen Öffentlichkeitsreferat zum heutigen Tag :
Mein Gefühl aus den Gesprächen, die ich geführt habe, und den Rückmeldungen, die ich bekam, ist schon, dass die grundsätzliche Idee aufgegangen ist: dass viele Besucherinnen und Besucher in den verschiedenen Foren gute Anregungen für die eigene Gemeindearbeit gefunden und diese mit nach Hause genommen haben. Klar war es über weite Strecken ein "Klassentreffen" der pfälzisch kirchlich Engagierten, ein Treffen vieler Altbekannter. Und doch kennt man doch bei weitem nicht jede Idee, nicht jedes Projekt, das anderswo umgesetzt wird, schon gar nicht im Detail.
Insgesamt verlief der Zukunftskongress exakt so, wie vom Vorbereitungskreis konzipiert. Aus einer anders zusammengesetzten Steuerungsgruppe wäre ein anderes Konzept erwachsen, aber ich denke, entscheidend ist, sich irgendwann, möglichst zeitig, für ein Konzept zu entscheiden und es dann umzusetzen. Das schließt nicht aus, dass man an der einen oder anderen Stelle doch hätte flexibler agieren können. Aber es folgt ja noch eine Auswertung.
Auch die Aspekte, die Organisatoren nicht in der Hand haben können, stimmten: Die Stadt zeigte sich von ihrer besten Seite, die Sonne strahlte vom Himmel, und "Swingin' Lautern" erzeugte fast Kirchentagsatmosphäre, obwohl die Titelauswahl zwangsläufig nach anderen Kriterien erfolgte ...
Von mir selbst fiel der Druck ab, nachdem die Auftaktveranstaltung in der Fruchthalle vorüber war - und mit den verschiedenen Präsentationen nichts daneben ging, kein Video plötzlich verschwunden, kein Text verschoben, der Beamer nicht von der Hallendecke gestürzt war. Mein Vorhaben, mindestens vier Foren zu besuchen und überall Kurzinterviews zu führen, erwies sich als illusorisch, weil sich sowohl morgens im Forum Bildung und Unterricht als auch nachmittags im Forum Taufe aus den Interviews im Anschluss noch längere Gespräche ergaben. Die wenigen Interviews, die ich geführt habe, werde ich nach und nach auf Posterous einstellen und via Twitter und Facebook zum Anhören verlinken.
Hier noch die Pressemitteilungen aus dem landeskirchlichen Öffentlichkeitsreferat zum heutigen Tag :
- "Hier trifft Theologie auf Wirklichkeit" - Rund 80 Beispiele aus der Gemeindepraxis zeigt der Zukunftskongress
- Schad weist Weg in die Zukunft: "Kräfte bündeln und Visionen entwickeln"
- Die Ansprache des Kirchenpräsidenten im Wortlaut
- Beck: Kirche soll sich in gesellschaftliche Debatten einmischen
Sonntag, 22. Mai 2011
Dienstag, 17. Mai 2011
Facebook-Gottesdienst vs. evangelisch.de-Chatandacht
Weil ich es schade fände, wenn die nachfolgende Diskussion in den Kommentartiefen dieses Blogs versickert, hieve ich sie einmal in einen eigenen Eintrag. Ich hatte im zweiten Teil meiner Zusammenfassung vom Barcamp Kirche vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem Twittergottesdienst die Frage gestellt,
"welche Möglichkeiten die Plattform Facebook für einen Online-Gottesdienst böte. Möglich wäre, dort eine Gottesdienst-Gruppe zu gründen. Der Gottesdienst selbst könnte hauptsächlich im Gruppenchat ablaufen. Die Gruppen-Pinnwand könnte sich für Bildmeditationen eignen: das Bild auf die Pinnwand posten, eine kurze Auslegung dazu in den Kommentar. Die Gottesdienstteilnehmer könnten mit weiteren Kommentaren reagieren. Auch könnte man auf der Pinnwand Audiodateien oder Youtube-Videos zu den Liedern verlinken. Bisher habe ich noch an keiner Chat-Andacht auf evangelisch.de teilgenommen. Was meint ihr: Welche Vor- und Nachteile hätte ein solcher Facebook-Gottesdienst gegenüber der Plattform evangelisch.de?"Ingo kommentierte:
"Ich finde die Idee ziemlich spannend und kann im Moment auf FB nur Vorteile sehen. Auf FB vernetzt sich die Welt, während evangelisch.de doch nur eine eng begrenzte Usercommunity hat. Leute ließen sich bei FB wahrscheinlich problemloser einladen (weil sie da ohnehin schon sind), wodurch sich auch ein gewisser Outreach-Effekt erreichen ließe - falls man das will. Und die technischen Möglichkeiten (die du oben beschrieben hast) sind bei FB einfach reichhaltiger und schneller."Woraufhin ich - obgleich intensiver Facebook-Nutzer - versuchte,
"eine Lanze für evangelisch.de zu brechen, und zwar vor dem Hintergrund von Überlegungen, wie sie in einer der Sessions auf dem Barcamp angestellt wurden. Dabei ging es um die Tatsache, dass Andachtsräume im Real Life ja bewusst gestaltet werden können bzw. von vornherein bereits für Gottesdienstliches gestaltet sind (Kirchengebäude). Natürlich kann man sich für die Chat-Andacht zu Hause eine Kerze anzünden etc. Aber was man auf dem Bildschirm sieht, könnte ja auch dem Anlass entsprechend aussehen (Farbgebung, virtuelle Kerzen, christliche Symbolik). Wenn wir nun einen virtuellen Andachtsraum bewusst gestaltet haben wollen (und wir nicht gerade den Aufwand eines Kirchenbaus in Second Life auf uns nehmen wollen), dann kann sich das evangelisch.de-Team darauf einlassen, wird es vermutlich sogar gerne tun, während diese Möglichkeit bei FB wahrscheinlich gar nicht bestehen wird. Das mal als ein Argument pro evangelisch.de - vielleicht braucht man ja auch gar nicht beides gegeneinander auszuspielen ..."Christian plädierte ebenfalls für evangelisch.de:
"In Sachen virtueller Gottesdienst spricht aus meiner Sicht vieles für evangelisch.de und - außer dem Outreach-Argument - eher wenig für Facebook. Das gewichtigste Gegenargument ist meines Erachtens nach die fehlende Kontrolle über die Plattform - als Facebook-Nutzer weiß man ja schon, dass sich alle paar Wochen oder Monate kleine und manchmal auch große Veränderungen ergeben, ohne das eine "Vorwarnung" der Nutzer stattfindet. Eine solche Plattform mag zwar zum Networken gut geeignet sein, bietet jedoch keine ausreichend stabile Umgebung für Veranstaltungen wie virtuelle Gottesdienste, für die man einigermaßen feste Strukturen benötigen würde..."Wie gesagt: Vielleicht ist es gar nicht nötig, beides gegeneinander auszuspielen - jedenfalls nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Evangelisch.de könnte ja selbst einmal zum Facebook-Gottesdienst einladen - und ein anderes Mal umgekehrt auf Facebook zur Chatandacht auf evangelisch.de einladen. Wir sind ja ohnehin noch in der Phase des Testens und Ausprobierens, und ich denke, wir sollten mit beidem Erfahrungen sammeln. Im Endeffekt bedeutet das wahrscheinlich, dass sich beides nebeneinander etablieren wird ... :-)
Samstag, 14. Mai 2011
Rückblick aufs Barcamp Kirche im Web 2.0 - Teil 2 #kir20bc
[zu Teil 1 meines Barcamp-Rückblicks]
Meine noch im Laufe des Barcamps erstellten Folien zum "Neuen Atheismus im Web 2.0", bildeten, so mein Eindruck, eine recht gute Diskussionsgrundlage für die an Session 6 Interessierten. Natürlich erheben sie weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Abgeschlossenheit:
Die Idee, ein Buch (das ja auch von mehreren Autoren, z.B. mit Hilfe von Google Docs, verfasst werden könnte), ein Wiki oder eine FAQ (Vorschlag aus der Runde) über "Die Klischees der Neuen Atheisten" anzugehen, stieß auf erfreuliche Resonanz. Bei Gelegenheit werde ich mich einmal an einer etwas detaillierteren Projektskizze versuchen. Ich glaube übrigens, dass ein solches Werk - trotz des leicht polemischen Arbeitstitels - keine Kampfansage an die Adresse der Neuen Atheisten wäre, sondern ausgehend von schlicht und ergreifend sachlich falschen Aussagen oder einseitigen Interpretationen auf ein kleines Kompendium der Grundlagen des christlichen Glaubens (Existenz Jesu, Bedeutung der Bibel) und des Verhältnisses von Kirche bzw. Religion und Staat hinausliefe. Ich stelle mir fundierte, mit Quellen belegte Sachinformation vor - was erhellende illustrierende Beispiele oder Vergleiche nicht ausschließt, wohl aber primitive Gegenpolemik.
In Session 7 fand sich ein kleines Grüppchen Barcamp-Teilnehmer/innen zusammen, um die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für einen Twittergottesdienst am Sonntagmorgen festzulegen. Zu Heiko Kuschels ausführlichem Bericht über dieses liturgische Experiment will ich nur noch folgende Punkte hinzufügen:
- Zunächst einmal war es eine Freude, mit Heiko gemeinsam am Abend (während andere sich in der Ebbelwoi-Kneipe vergnügten, die wir allerdings schon am Vortag genossen hatten) diesen Gottesdienst vorzubereiten. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich zwei, die einander zuvor nie begegnet waren und zudem noch verschiedenen landeskirchlich-liturgischen Traditionen entstammen, zusammensetzen, auf Anhieb eine gemeinsame Linie finden und ohne größere Stolpersteine "rund" bekommen. Eine wichtige Grundlage dafür war freilich Heikos Vorschlag, die "Gemeinschaft der Eiligen" zum Thema zu machen, worauf ich mich sofort einlassen konnte. Wie daraufhin eine Idee die andere ergab und gemeinsam ein Ganzes entstand, war eine wunderbare Erfahrung, für die ich Heiko danke, aber auch den Organisatoren des Barcamps, das ja den äußeren Rahmen vorgab. Und natürlich ist allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Twigo zu danken, ob vor Ort in Frankfurt oder irgendwo sonst am Bildschirm, denn sie gönnten auch uns Liturgen eine nicht alltägliche Erfahrung. Wie oft kommt es schon vor, dass man als Prediger vor der Herausforderung steht, Eingaben der Gottesdienstgemeinde mit aufzugreifen und spontan in die Ansprache hinein zu verflechten?
- Für kommende Twittergottesdienste sind Urheberrechtsfragen zu klären, was die Verwendung von Bibeltexten, Liedblättern, Live-Musik und ihre Übertragung ins Netz betrifft (sei es per Twitter- oder Audio- oder Videostream). Bezogen auf Bibeltexte ist das Projekt "Offene Bibel" ja schon auf einem guten Weg. Ist Ähnliches im Hinblick auf Liedgut denkbar? Gemeinfreie Lieder könnten (z.B. online mit Noteflight oder offline mit MuseScore) neu gesetzt und damit auch das Notenbild gemeinfrei gemacht werden (vgl. diese Sammlung gemeinfreier Weihnachtslieder). Textlich müsste man dann allerdings zum Teil auf nicht mehr ganz zeitgemäße Varianten zurückgreifen. Auf NGL (Neue Geistliche Lieder) müssten wir ganz verzichten (was manche wohl gar nicht schlecht fänden). Möglicherweise gibt es aber ja sogar begabte Liedschreiber in unseren Barcamp-Reihen, die etwas von diesem Handwerk verstehen? Vielleicht könnte auch hier manches in Online-Zusammenarbeit entstehen?
- Und schließlich habe ich mich gefragt, welche Möglichkeiten die Plattform Facebook für einen Online-Gottesdienst böte. Möglich wäre, dort eine Gottesdienst-Gruppe zu gründen. Der Gottesdienst selbst könnte hauptsächlich im Gruppenchat ablaufen. Die Gruppen-Pinnwand könnte sich für Bildmeditationen eignen: das Bild auf die Pinnwand posten, eine kurze Auslegung dazu in den Kommentar. Die Gottesdienstteilnehmer könnten mit weiteren Kommentaren reagieren. Auch könnte man auf der Pinnwand Audiodateien oder Youtube-Videos zu den Liedern verlinken. Bisher habe ich noch an keiner Chat-Andacht auf evangelisch.de teilgenommen. Was meint ihr: Welche Vor- und Nachteile hätte ein solcher Facebook-Gottesdienst gegenüber der Plattform evangelisch.de?
Session 8 berief ich ein mit der Begründung, ich bräuchte noch eine definitive dienstliche Rechtfertigung für meine Anwesenheit auf dem Barcamp. Das Thema lag damit nahe: Welche Erfahrungen gibt es mit der Entwicklung einer Social Media Strategie für Landeskirchen (durch Andreas Artikel ging mir auf, wie unökumenisch ich bei dieser Themenankündigung dachte. Also:) und Diözesen? Wie sehen aktuelle landeskirchliche Facebook-Seiten aus? Wer steht dahinter? Welche Ziele werden damit verfolgt? Hier meine Mitschrift dieser Session:
kir20bc - social media strategie für die landeskirche
In Session 9 ging es noch um die Unterschiede zwischen Gemeindebrief, Web 1.0 und Web 2.0, die Feststellung, dass alle Medienformen sich gegenseitig ergänzen und Gemeinden deshalb das eine tun und das andere nicht lassen sollten - und dann war bei mir die Luft raus, so dass ich Session-Slot 10 ausließ. Die einzige angesetzte Session war Jens Neuhaus mit "Gemeinde 2.0". Hier sein öffentliches Brainstorming-Notizbuch dazu: http://ietherpad.com/aj7t1xXz31.
Eine gemütliche Dreiviertelstunde im personell eher spärlich besetzten Plenumssaal mit der Atmosphäre des beginnenden Anfangs vom Ende des Barcamps war dagegen genau das, was ich zum Ausklang dieser insgesamt äußerst gewinnbringenden Tagung brauchte. Wenn es terminlich passt, bin ich im nächsten Jahr wieder dabei!
Wer über die in meinem Rückblick Verlinkten hinaus sonst noch übers Barcamp schrieb (die meisten der folgenden Links sind frech geklaut bei Benjamin Koppe):
Meine noch im Laufe des Barcamps erstellten Folien zum "Neuen Atheismus im Web 2.0", bildeten, so mein Eindruck, eine recht gute Diskussionsgrundlage für die an Session 6 Interessierten. Natürlich erheben sie weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Abgeschlossenheit:
Die Idee, ein Buch (das ja auch von mehreren Autoren, z.B. mit Hilfe von Google Docs, verfasst werden könnte), ein Wiki oder eine FAQ (Vorschlag aus der Runde) über "Die Klischees der Neuen Atheisten" anzugehen, stieß auf erfreuliche Resonanz. Bei Gelegenheit werde ich mich einmal an einer etwas detaillierteren Projektskizze versuchen. Ich glaube übrigens, dass ein solches Werk - trotz des leicht polemischen Arbeitstitels - keine Kampfansage an die Adresse der Neuen Atheisten wäre, sondern ausgehend von schlicht und ergreifend sachlich falschen Aussagen oder einseitigen Interpretationen auf ein kleines Kompendium der Grundlagen des christlichen Glaubens (Existenz Jesu, Bedeutung der Bibel) und des Verhältnisses von Kirche bzw. Religion und Staat hinausliefe. Ich stelle mir fundierte, mit Quellen belegte Sachinformation vor - was erhellende illustrierende Beispiele oder Vergleiche nicht ausschließt, wohl aber primitive Gegenpolemik.
In Session 7 fand sich ein kleines Grüppchen Barcamp-Teilnehmer/innen zusammen, um die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für einen Twittergottesdienst am Sonntagmorgen festzulegen. Zu Heiko Kuschels ausführlichem Bericht über dieses liturgische Experiment will ich nur noch folgende Punkte hinzufügen:
- Zunächst einmal war es eine Freude, mit Heiko gemeinsam am Abend (während andere sich in der Ebbelwoi-Kneipe vergnügten, die wir allerdings schon am Vortag genossen hatten) diesen Gottesdienst vorzubereiten. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich zwei, die einander zuvor nie begegnet waren und zudem noch verschiedenen landeskirchlich-liturgischen Traditionen entstammen, zusammensetzen, auf Anhieb eine gemeinsame Linie finden und ohne größere Stolpersteine "rund" bekommen. Eine wichtige Grundlage dafür war freilich Heikos Vorschlag, die "Gemeinschaft der Eiligen" zum Thema zu machen, worauf ich mich sofort einlassen konnte. Wie daraufhin eine Idee die andere ergab und gemeinsam ein Ganzes entstand, war eine wunderbare Erfahrung, für die ich Heiko danke, aber auch den Organisatoren des Barcamps, das ja den äußeren Rahmen vorgab. Und natürlich ist allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Twigo zu danken, ob vor Ort in Frankfurt oder irgendwo sonst am Bildschirm, denn sie gönnten auch uns Liturgen eine nicht alltägliche Erfahrung. Wie oft kommt es schon vor, dass man als Prediger vor der Herausforderung steht, Eingaben der Gottesdienstgemeinde mit aufzugreifen und spontan in die Ansprache hinein zu verflechten?
- Für kommende Twittergottesdienste sind Urheberrechtsfragen zu klären, was die Verwendung von Bibeltexten, Liedblättern, Live-Musik und ihre Übertragung ins Netz betrifft (sei es per Twitter- oder Audio- oder Videostream). Bezogen auf Bibeltexte ist das Projekt "Offene Bibel" ja schon auf einem guten Weg. Ist Ähnliches im Hinblick auf Liedgut denkbar? Gemeinfreie Lieder könnten (z.B. online mit Noteflight oder offline mit MuseScore) neu gesetzt und damit auch das Notenbild gemeinfrei gemacht werden (vgl. diese Sammlung gemeinfreier Weihnachtslieder). Textlich müsste man dann allerdings zum Teil auf nicht mehr ganz zeitgemäße Varianten zurückgreifen. Auf NGL (Neue Geistliche Lieder) müssten wir ganz verzichten (was manche wohl gar nicht schlecht fänden). Möglicherweise gibt es aber ja sogar begabte Liedschreiber in unseren Barcamp-Reihen, die etwas von diesem Handwerk verstehen? Vielleicht könnte auch hier manches in Online-Zusammenarbeit entstehen?
- Und schließlich habe ich mich gefragt, welche Möglichkeiten die Plattform Facebook für einen Online-Gottesdienst böte. Möglich wäre, dort eine Gottesdienst-Gruppe zu gründen. Der Gottesdienst selbst könnte hauptsächlich im Gruppenchat ablaufen. Die Gruppen-Pinnwand könnte sich für Bildmeditationen eignen: das Bild auf die Pinnwand posten, eine kurze Auslegung dazu in den Kommentar. Die Gottesdienstteilnehmer könnten mit weiteren Kommentaren reagieren. Auch könnte man auf der Pinnwand Audiodateien oder Youtube-Videos zu den Liedern verlinken. Bisher habe ich noch an keiner Chat-Andacht auf evangelisch.de teilgenommen. Was meint ihr: Welche Vor- und Nachteile hätte ein solcher Facebook-Gottesdienst gegenüber der Plattform evangelisch.de?
Session 8 berief ich ein mit der Begründung, ich bräuchte noch eine definitive dienstliche Rechtfertigung für meine Anwesenheit auf dem Barcamp. Das Thema lag damit nahe: Welche Erfahrungen gibt es mit der Entwicklung einer Social Media Strategie für Landeskirchen (durch Andreas Artikel ging mir auf, wie unökumenisch ich bei dieser Themenankündigung dachte. Also:) und Diözesen? Wie sehen aktuelle landeskirchliche Facebook-Seiten aus? Wer steht dahinter? Welche Ziele werden damit verfolgt? Hier meine Mitschrift dieser Session:
kir20bc - social media strategie für die landeskirche
In Session 9 ging es noch um die Unterschiede zwischen Gemeindebrief, Web 1.0 und Web 2.0, die Feststellung, dass alle Medienformen sich gegenseitig ergänzen und Gemeinden deshalb das eine tun und das andere nicht lassen sollten - und dann war bei mir die Luft raus, so dass ich Session-Slot 10 ausließ. Die einzige angesetzte Session war Jens Neuhaus mit "Gemeinde 2.0". Hier sein öffentliches Brainstorming-Notizbuch dazu: http://ietherpad.com/aj7t1xXz31.
Eine gemütliche Dreiviertelstunde im personell eher spärlich besetzten Plenumssaal mit der Atmosphäre des beginnenden Anfangs vom Ende des Barcamps war dagegen genau das, was ich zum Ausklang dieser insgesamt äußerst gewinnbringenden Tagung brauchte. Wenn es terminlich passt, bin ich im nächsten Jahr wieder dabei!
Wer über die in meinem Rückblick Verlinkten hinaus sonst noch übers Barcamp schrieb (die meisten der folgenden Links sind frech geklaut bei Benjamin Koppe):
- Knut Dahl macht sich unter anderem Gedanken zu einem Liturgen beim Twitter-Gottesdienst
- Johannes Müller erklärt den Unterschied zwischen Kirche 1.0 und Kirche 2.0
- Nochmal Johannes Müller, diesmal mit einem Aufruf zur Diskussion über Twitter und Gottesdienst
- In den Kommentaren von Johannes’ Aufruf hat Norbert Gast (ist das der richtige Name?) nen Link zum virtuellen Andachtsraum der evangelischen Kirche in Frankfurt/Main reingestellt
- Andrea Mayer Edoloeyi hat Tweets vom Twittergottesdienst zusammengestellt
- Und Andrea hat einen ausführlichen Rückblick aufs Barcamp geschrieben.
- Christiane Müller hat einen subjektiven Bericht aus der Sicht einer „Offlinerin“ geschrieben
- Benjamin Koppe selbst machte sich - obwohl nicht persönlich anwesend - ebenfalls ausführlich Gedanken zum Barcamp
- Und er entwickelte daraus diese Anregung zu einem "Ewigen Lobpreis" auf Twitter.
Dienstag, 10. Mai 2011
Rückblick aufs Barcamp Kirche im Web 2.0 - Teil 1 #kir20bc
 Stell dir vor, du meldest dich für eine Tagung an, ohne zu wissen, was dort eigentlich passieren wird.
Stell dir vor, du meldest dich für eine Tagung an, ohne zu wissen, was dort eigentlich passieren wird.Stell dir vor, das liegt nicht daran, dass du dich nicht ausreichend informiert hast, sondern weil es die Organisatoren selbst nicht wissen.
Stell dir vor, das funktioniert trotzdem: Es wird hochmotiviert miteinander gearbeitet und diskutiert, dein Kopf ist voller neuer Ideen und Gedanken, bislang Unstrukturiertes gewinnt plötzlich Form - und darüber hinaus erlebst du noch eine tolle Gemeinschaft von lauter interessanten Menschen.
Das ist Barcamp. Eine Tagungsform, die ganz auf die Kompetenzen, das Wissen und die Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzt. Am Anfang eines jeden Tages steht die Sessionplanung; diejenigen Teilnehmer, die einen Inhalt präsentieren oder sich darüber austauschen wollen, stellen ihr Thema dem Plenum kurz vor, fragen das Interesse ab und belegen dann damit einen der 45-minütigen Session Slots in einem der zur Verfügung stehenden Räume. Und dann? Ja, dann geht's zur Sache.
 statt, ausgerichtet von evangelisch.de. Ich selbst war zum ersten Mal bei einem solchen Barcamp dabei. In den Wochen und Tagen zuvor war die Vorfreude täglich gestiegen - mehr, als ich dies von anderen Tagungen kenne. Die möglichen Sessions, die sich schon im Vorfeld abzeichneten, der Vorab-Austausch auf Twitter, Facebook und im Forum von kirche20.mixxt.de, sowie die Aussicht, viele der Menschen, mit denen ich bis dato nur virtuell Kontakt hatte, nun endlich einmal persönlich kennen zu lernen, das alles trug zu diesem Gefühl wohl entscheidend bei.
statt, ausgerichtet von evangelisch.de. Ich selbst war zum ersten Mal bei einem solchen Barcamp dabei. In den Wochen und Tagen zuvor war die Vorfreude täglich gestiegen - mehr, als ich dies von anderen Tagungen kenne. Die möglichen Sessions, die sich schon im Vorfeld abzeichneten, der Vorab-Austausch auf Twitter, Facebook und im Forum von kirche20.mixxt.de, sowie die Aussicht, viele der Menschen, mit denen ich bis dato nur virtuell Kontakt hatte, nun endlich einmal persönlich kennen zu lernen, das alles trug zu diesem Gefühl wohl entscheidend bei.Das Barcamp selbst erhält seine besondere Atmosphäre auch durch die intensive Begleitung über Twitter. Über den vorab festgelegten Hashtag #kir20bc war es möglich, sowohl innerhalb einer Session sozusagen ein stilles Begleitgespräch zum jeweiligen Thema zu führen - als auch mitzubekommen, was in den anderen Sessions gerade lief.
Die folgenden Sessions bildeten für mich das Erlebnis Barcamp 2011:
In Session 1, einberufen von Ralf Peter Reimann, stand die Frage im Mittelpunkt, ob und inwiefern es möglich ist, "Spiritualität online" zu leben bzw. zu erfahren. Konkret ging es dabei um die Chat-Andachten, mit denen auf evangelisch.de schon einige Erfahrungen gesammelt wurden. Andrea Mayer-Edoloeyi, aus dem österreichischen Linz zum Barcamp angereiste katholische Theologin, hat ihre Mitschrift dazu dankenswerterweise ins Netz gestellt.
Die 2. Session, die ich besuchte, bot Andrea selbst an: "Social Media als Bottom-up-Bewegung in der Kirche". Ihre Präsentation dazu hat sie ebenfalls zum Abruf bereitgestellt, auf Slideshare.
Sehr erhellend fand ich dabei die Idee, den Vergleich zwischen Old und New Media (hierarchisch/top-down vs. vernetzt/bottom-up) auf das Gegenüber von Kirche als Religionsgemeinschaft und Kirche als Pastoralgemeinschaft anzuwenden - und wie nahezu zwangsläufig im ersten Verständnis ein Habitus des Mangels, im zweiten ein Habitus der Hoffnung entsteht. Andrea vermied aber den naheliegenden Kurzschluss, das eine durch das andere ablösen zu wollen, sondern gestand beiden Verständnissen ihr Existenzrecht zu: Die Religionsgemeinschaft kann durchaus Guidelines erarbeiten, Support anbieten und Monitoring betreiben, während beispielsweise Kommunikation und Seelsorge besser in der Verantwortung der Pastoralgemeinschaft aufgehoben ist. Nebenbei resultiert aus diesen Überlegungen auch die Feststellung dass und warum es für Institutionen (wie Landeskirchen) am schwierigsten ist, eine Facebook-Page zu betreuen. Einfacher ist es dagegen, die Gemeinden ins Web 2.0 zu bringen, und Andrea plädierte hier dafür, mit Adminrechten freizügig umzugehen, sprich: Ehrenamtlichen vertrauensvoll diese Verantwortung zu übertragen.
Ein für mich spannender Anknüpfungspunkt aus der Diskussion war für mich die These Antje Schrupps, Social Media werde dazu führen, dass die Autorität von Amtspersonen abnehmen werde. Wird das so sein? Welche "Autorität" ist eigentlich gemeint? Wir reden doch gerne vom "Vertrauensvorschuss", den Menschen dem Pfarrer, der Pfarrerin entgegenbringen. Ich gehe davon aus, dass viele meiner Twitterfollower nur deshalb begonnen haben, mir zu folgen, weil da "Pfarrer" im Profil steht. Wird das künftig keine Rolle mehr spielen? Was stattdessen?
Mit Session 3 entschied ich mich für ein altbekanntes Thema: Podcasting. Altbekannt deshalb, weil ich schon 2006 in meiner damaligen Funktion als Evangelischer Privatfunkbeauftragter für Rheinland-Pfalz einen der ersten landeskirchlichen Podcasts realisierte: den "ProtCast Pfalz". Natürlich gehört er zu den eher institutionellen, offiziellen Angeboten, wie sie parallel und in der Folge von vielen Radiosendern und kirchlichen Rundfunkagenturen als selbstverständlicher Zweitverwertungs- und Nachhörkanal eingerichtet wurden. Daneben habe ich stets die private Podcast-Szene als reizvoll empfunden (für mich v.a. verbunden mit den Namen Annik Rubens, Alex Wunschel, Norman Osthus - sowie christlicherseits mit Father Roderick, Pfarrer Hans Spiegl). Alles geborene Labertaschen, die dank Podcasting frei von irgendwelchen Formatvorgaben einfach das Hörprogramm machen können, das ihnen Spaß macht. Maria Schmidts Idee mit ihrer Session war nun, einen Podcast unter dem Titel "The little web service - Der Podcast über Gott, die Welt und das Internet" zu initiieren. Grundgedanke ist, über Twitter und Facebook Fragen und Themen zu sammeln und zur Beantwortung via Skype-Interviews auf die vielfältigen Kompetenzen zurückzugreifen, die in der christlichen Web-2.0-Szene vorhanden sind. Marias Präsentation findet sich auf Slideshare; mittlerweile hat sie bereits eine (geschlossene) Facebook-Gruppe gegründet, in der auch schon die Planung für die erste Folge (ein Rückblick aufs Barcamp) angelaufen ist.
Session 4 habe ich ausgelassen, um gemütlich im Plenumssaal sitzen zu bleiben und meine eigene Atheismus-Session vorzubereiten - nebenbei ging der Blick natürlich immer wieder zur Twitterwall.
In Session 5, wieder einberufen von Ralf Peter Reimann, ging es um die Frage, ob eine Internetcommunity als vollgültige Gemeinde, Online-Gemeinde eben, gelten kann, theologisch wie kirchenrechtlich. Auch hierzu hat Andrea eine Mitschrift angefertigt. Da wurden Vergleiche gezogen zwischen Netikette und Hausrecht: Ist von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen zu werden dasselbe wie von einer Internetcommunity? Ist die Face-to-Face-Begegnung zwingend erforderlich zur Definition dessen, was Gemeinde ist? Gibt es, wie Kollege Horst Peter Pohl formulierte, zwar "Gemeinde online, aber nicht Online-Gemeinde"? Dass es möglich sein könnte, einen Online-Gottesdienst mit Abendmahl zu feiern, wurde mehrheitlich ausgeschlossen - vgl. dazu aber den Beitrag von Benjamin Koppe, der beim Barcamp leider nicht dabei war. Klar war, dass diese Session nur dazu dienen konnte, die Fragenkomplexe anzureißen und gedanklich zu strukturieren, aber nicht abschließend zu beantworten.
[weiter zu Teil 2 des Barcamp-Rückblicks]
Mittwoch, 4. Mai 2011
Wachsen gegen den Trend? - Noch einmal "Gemeinde 2.0" #gem20
Es ist nötig und vor allem ein Gebot der Fairness, meinem Rückblick auf die Konferenz "Gemeinde 2.0" vom 30. März eine Ergänzung bzw. Korrektur angedeihen zu lassen. Ich gab dort eine sehr gedrängte Zusammenfassung des Seminars "Die Chancen des Schrumpfens". Diese enthielt die Aussage, das "Resümee" der beiden Referenten sei gewesen: "Die im EKD-Impulspapier von 2006 ausgegebene Parole vom "Wachsen gegen den Trend" ist eine Illusion und Überforderung, die nur zu Frustration führen kann."
Daraufhin erreichte mich per E-Mail der Einspruch eines der beiden Referenten, Pfarrer Dr. Thomas Schlegel, der sich mit diesem Satz "gründlich missverstanden" fühlte. Er schreibt:
Wie sehen das die Leserinnen und Leser dieses Blogs?
[Thomas Schlegel hat übrigens über Karl Barth promoviert. Wer noch Lesestoff zu Barths 125. Geburtstag in einer Woche braucht ... ;-) ]
Daraufhin erreichte mich per E-Mail der Einspruch eines der beiden Referenten, Pfarrer Dr. Thomas Schlegel, der sich mit diesem Satz "gründlich missverstanden" fühlte. Er schreibt:
(...) Zweifellos war es unsere mit "harten Fakten" unterlegte Ausgangsbeobachtung (und eben gerade nicht das Resümee), daß die Rhetorik des Wachsens sich oft nicht mit der erfahrenen Wirklichkeit deckt. Davon ausgehend zu überlegen, wie mit dieser Spannung umzugehen ist und worin die Chancen des Weniger (konkret) liegen könnten, war der intendierte Gegenstand des Workshops (siehe Arbeitsphasen). (...)Darauf antwortete ich:
(...) Ich bitte um Entschuldigung, dass ich in der Darstellung Ihrer Position einen - offenbar recht tiefgreifenden - Fehler gemacht habe bzw. einer Fehleinschätzung unterlag. Vielleicht lässt es sich zum Teil aus der rezeptionsästhetischen Erkenntnis erklären, dass man (etwa als Predigthörer) gerne vor allem das "hört" und "mitnimmt", was die eigene Position oder Überzeugung unterstützt. Ich muss allerdings gestehen, dass mir auch jetzt, nach dem Lesen Ihrer Mail, noch nicht klar ist, worin genau der Fehler besteht bzw. wie man die von Ihnen präsentierten "harten Fakten" anders interpretieren kann als im Sinne eines Zurückweisens der Forderung nach einem "Wachsen gegen den Trend". Es ist doch so, dass es nicht in unseren menschlichen Kräften steht, den Mitgliederschwund der Kirche aufzuhalten oder gar umzukehren, selbst wenn wir keine Austritte mehr hinnehmen müssten - eben aufgrund der demografischen Entwicklung. Dann aber bedeutet die Selbstverpflichtung einer Kirchengemeinde, gegen den Trend wachsen zu wollen, eine permanente Überforderung und Quelle der Frustration - weil der Blick auf die nackten Zahlen am Ende eines jeden Jahres den Misserfolg belegt.Worauf wir langsam zusammenzufinden schienen, denn seine Antwort war:
"Die Chancen des Schrumpfens" sehe ich deshalb darin, dass uns der Rückgang geradezu dazu zwingt, nach (neuen) Formen Ausschau zu halten, wie lebendige Gemeinde künftig aussehen kann. Der Umbau muss mit dem Ziel geschehen, zu Strukturen zu finden, die es uns erlauben, unseren Kerngeschäften Gottesdienst, Seelsorge, Unterricht, Diakonie nachzugehen, ohne sich konstant mit den Fragen des Mitglieder- und Finanzrückgangs beschäftigen zu müssen. Vielleicht meinen Sie genau dies, wenn Sie von "Wachsen gegen den Trend" sprechen, meinen es also mehr geistlich-qualitativ als rein quantitativ!? Dann würde ich dringend zu einer anderen Wortwahl raten, so ist es zu missverständlich. (...)
(...) Mit der rezeptionsästhetischen Bemerkung zu Beginn haben Sie sicher Recht. Deswegen starte ich auch mit der Zusammenfassung ihres ersten Argumentes, wie ich es verstanden habe: Entweder wir blicken auf die "harten Zahlen" und müssen Wachstum ablehnen; oder wir reden von Wachstum und ignorieren die Realität. Bei offenen Augen von Wachstum zu reden brächte nur Frust.Und damit habe ich das Gefühl, dass Kollege Dr. Schlegel und ich doch eng beieinander liegen, was die Einschätzung der Situation und künftigen Entwicklung, und wie wir darauf reagieren können bzw. sollten, betrifft. Was er meint, dürfte dann wohl doch der Linie des Greifswalder Instituts-Chefs Michael Herbst entsprechen, zumindest diesen beiden Titeln nach zu urteilen (die ich inhaltlich nicht kenne):
Ich antworte darauf mit jener Dialektik, die auch schon dem Seminar zu Grunde lag:
Wir schrumpfen, aber uns ist zugleich Wachstum verheißen.
Wirklich spannend scheint mir zu sein, wie man diese beiden Dinge: Realität und Verheißung zusammenbekommt, ohne eines einfach zu kappen!
Und mit Ihrem zweiten Abschnitt sprechen Sie genau das aus, was ich meine:
Das Schrumpfen kann uns so reduzieren, daß darin Gesundungsprozesse und hoffentlich dann auch Keime für künftiges Wachstum liegen können. Vielleicht ist jetzt qualitatives Wachstum dran. Dies ist momentan die Verheißung, die ich sehe.
Dies wird man freilich vorsichtig zu äußern haben, denn Schrumpfen positiv zu belegen, wirkt zynisch oder weltfremd. (...)
- Deine Gemeinde komme. Wachstum nach Gottes Verheißungen
- Wachsende Kirche. Wie Gemeinde den Weg zu postmodernen Menschen finden kann (auf der Titelseite überschrieben mit "Kirche lebt - Glaube [!] wächst")
Wie sehen das die Leserinnen und Leser dieses Blogs?
[Thomas Schlegel hat übrigens über Karl Barth promoviert. Wer noch Lesestoff zu Barths 125. Geburtstag in einer Woche braucht ... ;-) ]
Mittwoch, 30. März 2011
Besser spät als nie: Mein Rückblick auf "Gemeinde 2.0" #gem20
Vor inzwischen schon fast drei Wochen - wie die Zeit vergeht - habe ich an der Konferenz "Gemeinde 2.0" in Filderstadt teilgenommen. Wie sich herausstellte, waren außer mir noch drei weitere Pfälzer Pfarrerskollegen mit dabei. Derzeit versuchen wir einigermaßen erfolglos, einen gemeinsamen Termin zu finden, um uns über die mitgenommenen Inhalte und Anregungen auszutauschen. Ich will hier in Stichpunkten schon einmal meine Gedanken zusammenfassen bzw. "verewigen":
- Eine Komplettzusammenfassung der Konferenz spare ich mir; das haben andere schon mit einem Bericht vor der württembergischen Landessynode und mit einem e-Magazin getan (in das auch einige meiner Twitternachrichten während der Konferenztage aufgenommen wurden). Auch auf churchconvention.de findet sich eine ausführliche Rückschau.
- Organisatorisch lässt sich kaum ein Haar in der Suppe finden. Die FILharmonie in Filderstadt war ein toller Veranstaltungsort, in dem die knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Programmpunkten im Plenum komfortabel Platz hatten; im unteren Bereich präsentierten sich verschiedene Initiativen und Projekte. Außerdem wurden die Räume der nahe gelegenen Realschule für Foren und Seminare mitgenutzt. Vom Medieneinsatz wie Videoeinspielern über Theateranspiele bis hin zur professionell aufspielenden Band (die sich schließlich auch als auf Apple-Instrumenten versiert präsentierte) stimmte alles. Einzig eine Garderobe habe ich vermisst.
- Man merkte, dass als einer der Veranstalter das Evangelische Jugendwerk in Württemberg fungierte: Es waren erstaunlich viele junge Leute da. Außerdem war die Konferenz deutlich auf Ermutigung, Motivation, Aufbruch hin angelegt. Das sorgte insgesamt für eine gute, hoffnungsfrohe Grundstimmung (die freilich durch die nach und nach eintröpfelnden Erdbebenmeldungen aus Japan getrübt wurde). Mir persönlich blieb es dadurch aber andererseits - gerade in den Plenumszusammenkünften - oft zu oberflächlich.
- Spätestens am 2. Tag war das Plenum außerdem redundant. Man musste Bischof Graham Cray natürlich genauso viel Raum (bzw. Zeit) einräumen wie Bischof Steven Croft am ersten Tag, aber er hatte nicht so viel anderes zu erzählen. Die Grundbotschaft, die vermittelt werden sollte, war dann doch recht schnell klar: Kirche darf sich nicht einigeln, nicht nur die Binnenperspektive einnehmen, nicht darauf warten, dass die Menschen zu ihr kommen, sondern muss sich auf den Weg hinaus machen, dorthin, wo die Menschen sind, und sich fragen, wie sie dort, vor Ort, die Menschen in ihren Lebenswirklichkeiten ansprechen und erreichen kann. Sie muss dazu Ideen für "Fresh Expressions" entwickeln, neue, frische Ausdrucksformen von Kirche.
- In den Projekten der anglikanischen Kirche hat dabei das gemeinsame Kochen und Essen oft eine große Bedeutung, so beispielsweise in dem präsentierten Brotback-Projekt mit Obdachlosen.
- Verschiedene Schlagworte tauchten im Lauf der Konferenz immer wieder auf. "Fresh Expressions" habe ich schon genannt. Dann: "Church Planting". Die Anglikaner verstehen ihre Vor-Ort-bei-den-Menschen-Initiativen nicht als Projekte einer Kirchengemeinde, sondern als Gemeindeneugründungen, als eigenständige Gemeinde.
- Pioneers. Konsequenterweise ist es notwendig, zum Church Planting gezielt Menschen zu entsenden, die sich fortan nur dieser Aufgabe widmen: Pioniere.
- "Dying to live": Ich habe gehört, dass die Konferenz eigentlich diesen Titel tragen sollte, was dann aber wohl doch zu gewagt erschien. Es geht um die Ermutigung, auch von kirchenleitender Seite, zum einen Risiken einzugehen - wie etwa dem, Pioniere zu entsenden und damit begabte, engagierte Leute für die eigene Gemeindearbeit zu verlieren, damit diese etwas Neues aufbauen können. Und zum anderen, dafür auch etwas sterben lassen zu können, aber natürlich Trauerbegleitung anzubieten. Dying to live - natürlich steht dahinter der Gedanke an Tod und Auferstehung Jesu.
- Schließlich "mixed economy": Mehrfach wurde deutlich gemacht, dass es nicht darum geht, die Parochie, die Ortsgemeinde, abzulösen und sich nur noch auf die "Fresh Expressions" zu konzentrieren. Sondern es wurde für eine "Mischwirtschaft" aus alten und neuen Formen plädiert.
- Bischof Graham Cray sagte in einem Nebensatz, es seien im Zuge der Umsetzung des Positionspapiers "Mission-shaped Church" sehr viele ganz unspektakuläre neue Formen von Kirche entstanden. Nun: Genau diese hätten mich mal interessiert, weil sie sicher auf unsere Situation "übertragbarer" gewesen wären als etwa die "Skater Church". Vielleicht kamen diese Projekte in einem der vielen Seminare auf den Tisch?
- Recht zufrieden war ich mit dem Seminar, das ich mir ausgesucht hatte: "Die Chancen des Schrumpfens", dargeboten von zwei Referenten des Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung in Greifswald. Sie fassten sehr prägnant und mit aussagekräftigen Folien die demografische und Kirchenmitgliederentwicklung zusammen, also die "hard facts", an denen wir nicht vorbei kommen. Ihr Resümee lautete dahingehend, wie es auch unser pfälzischer Kirchenpräsident Christian Schad schon verschiedentlich formuliert hat: Die im EKD-Impulspapier von 2006 ausgegebene Parole vom "Wachsen gegen den Trend" ist eine Illusion und Überforderung, die nur zu Frustration führen kann. Damit war dieses Seminar eigentlich gegenläufig zur sonstigen Ausrichtung von "Gemeinde 2.0", die mehr der "Church-Growth"-Bewegung entsprang. Vgl. dazu diese kritische Auseinandersetzung des Studienleiters des Theologischen Studienseminars der VELKD mit dieser Bewegung und mit Michael Herbst, einem der Hauptredner der Konferenz in Filderstadt (Video) - und Leiter des Greifswalder Instituts.
[UPDATE 04.05.2011: Die Inhalte dieses Seminars betreffend war eine korrigierende Ergänzung erforderlich, die in einen eigenen Blogeintrag mündete.]
- Den interessanten Vortrag über die Milieuperspektive von Heinzpeter Hempelmann gibt es online als Video und als pdf-Download
- Alle Referate aus Plenum und Foren gibt es auf der Gemeinde-2.0-Homepage zum Nachhören im mp3-Format
- Das Forum "Social Media" am Samstagnachmittag konnte man weitgehend in die Tonne treten. Obwohl damit zu rechnen war, dass Twitterer anwesend sein würden, war nicht für WLAN gesorgt worden. Es folgte zum Auftakt eine Peinlichkeit, als das aus dem Netz abgespielte Einstiegsvideo natürlich hängenblieb und schließlich abgebrochen werden musste. Und die Gesprächsrunde verlor sich dann in halbgarem Gefasel mit wenigen Konkretionen; neue Ideen gab es schon gar nicht (wenn Videoübertragungen in Gottesdiensträume als Social Media verkauft werden, muss ich mich was fragen). Das war enttäuschend.
Aber mit diesem harten Urteil will ich nicht enden, denn insgesamt war die Konferenz durchaus anregend und motivierend. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle mehr "Butter bei die Fische" gewünscht, und lieber ein Seminar mehr, dafür eine Plenumsveranstaltung weniger gehabt. Und: Ich habe mir endlich die beiden "Milieus praktisch"-Bände zugelegt.
- Eine Komplettzusammenfassung der Konferenz spare ich mir; das haben andere schon mit einem Bericht vor der württembergischen Landessynode und mit einem e-Magazin getan (in das auch einige meiner Twitternachrichten während der Konferenztage aufgenommen wurden). Auch auf churchconvention.de findet sich eine ausführliche Rückschau.
- Organisatorisch lässt sich kaum ein Haar in der Suppe finden. Die FILharmonie in Filderstadt war ein toller Veranstaltungsort, in dem die knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Programmpunkten im Plenum komfortabel Platz hatten; im unteren Bereich präsentierten sich verschiedene Initiativen und Projekte. Außerdem wurden die Räume der nahe gelegenen Realschule für Foren und Seminare mitgenutzt. Vom Medieneinsatz wie Videoeinspielern über Theateranspiele bis hin zur professionell aufspielenden Band (die sich schließlich auch als auf Apple-Instrumenten versiert präsentierte) stimmte alles. Einzig eine Garderobe habe ich vermisst.
- Man merkte, dass als einer der Veranstalter das Evangelische Jugendwerk in Württemberg fungierte: Es waren erstaunlich viele junge Leute da. Außerdem war die Konferenz deutlich auf Ermutigung, Motivation, Aufbruch hin angelegt. Das sorgte insgesamt für eine gute, hoffnungsfrohe Grundstimmung (die freilich durch die nach und nach eintröpfelnden Erdbebenmeldungen aus Japan getrübt wurde). Mir persönlich blieb es dadurch aber andererseits - gerade in den Plenumszusammenkünften - oft zu oberflächlich.
- Spätestens am 2. Tag war das Plenum außerdem redundant. Man musste Bischof Graham Cray natürlich genauso viel Raum (bzw. Zeit) einräumen wie Bischof Steven Croft am ersten Tag, aber er hatte nicht so viel anderes zu erzählen. Die Grundbotschaft, die vermittelt werden sollte, war dann doch recht schnell klar: Kirche darf sich nicht einigeln, nicht nur die Binnenperspektive einnehmen, nicht darauf warten, dass die Menschen zu ihr kommen, sondern muss sich auf den Weg hinaus machen, dorthin, wo die Menschen sind, und sich fragen, wie sie dort, vor Ort, die Menschen in ihren Lebenswirklichkeiten ansprechen und erreichen kann. Sie muss dazu Ideen für "Fresh Expressions" entwickeln, neue, frische Ausdrucksformen von Kirche.
- In den Projekten der anglikanischen Kirche hat dabei das gemeinsame Kochen und Essen oft eine große Bedeutung, so beispielsweise in dem präsentierten Brotback-Projekt mit Obdachlosen.
- Verschiedene Schlagworte tauchten im Lauf der Konferenz immer wieder auf. "Fresh Expressions" habe ich schon genannt. Dann: "Church Planting". Die Anglikaner verstehen ihre Vor-Ort-bei-den-Menschen-Initiativen nicht als Projekte einer Kirchengemeinde, sondern als Gemeindeneugründungen, als eigenständige Gemeinde.
- Pioneers. Konsequenterweise ist es notwendig, zum Church Planting gezielt Menschen zu entsenden, die sich fortan nur dieser Aufgabe widmen: Pioniere.
- "Dying to live": Ich habe gehört, dass die Konferenz eigentlich diesen Titel tragen sollte, was dann aber wohl doch zu gewagt erschien. Es geht um die Ermutigung, auch von kirchenleitender Seite, zum einen Risiken einzugehen - wie etwa dem, Pioniere zu entsenden und damit begabte, engagierte Leute für die eigene Gemeindearbeit zu verlieren, damit diese etwas Neues aufbauen können. Und zum anderen, dafür auch etwas sterben lassen zu können, aber natürlich Trauerbegleitung anzubieten. Dying to live - natürlich steht dahinter der Gedanke an Tod und Auferstehung Jesu.
- Schließlich "mixed economy": Mehrfach wurde deutlich gemacht, dass es nicht darum geht, die Parochie, die Ortsgemeinde, abzulösen und sich nur noch auf die "Fresh Expressions" zu konzentrieren. Sondern es wurde für eine "Mischwirtschaft" aus alten und neuen Formen plädiert.
- Bischof Graham Cray sagte in einem Nebensatz, es seien im Zuge der Umsetzung des Positionspapiers "Mission-shaped Church" sehr viele ganz unspektakuläre neue Formen von Kirche entstanden. Nun: Genau diese hätten mich mal interessiert, weil sie sicher auf unsere Situation "übertragbarer" gewesen wären als etwa die "Skater Church". Vielleicht kamen diese Projekte in einem der vielen Seminare auf den Tisch?
- Recht zufrieden war ich mit dem Seminar, das ich mir ausgesucht hatte: "Die Chancen des Schrumpfens", dargeboten von zwei Referenten des Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung in Greifswald. Sie fassten sehr prägnant und mit aussagekräftigen Folien die demografische und Kirchenmitgliederentwicklung zusammen, also die "hard facts", an denen wir nicht vorbei kommen. Ihr Resümee lautete dahingehend, wie es auch unser pfälzischer Kirchenpräsident Christian Schad schon verschiedentlich formuliert hat: Die im EKD-Impulspapier von 2006 ausgegebene Parole vom "Wachsen gegen den Trend" ist eine Illusion und Überforderung, die nur zu Frustration führen kann. Damit war dieses Seminar eigentlich gegenläufig zur sonstigen Ausrichtung von "Gemeinde 2.0", die mehr der "Church-Growth"-Bewegung entsprang. Vgl. dazu diese kritische Auseinandersetzung des Studienleiters des Theologischen Studienseminars der VELKD mit dieser Bewegung und mit Michael Herbst, einem der Hauptredner der Konferenz in Filderstadt (Video) - und Leiter des Greifswalder Instituts.
[UPDATE 04.05.2011: Die Inhalte dieses Seminars betreffend war eine korrigierende Ergänzung erforderlich, die in einen eigenen Blogeintrag mündete.]
- Den interessanten Vortrag über die Milieuperspektive von Heinzpeter Hempelmann gibt es online als Video und als pdf-Download
- Alle Referate aus Plenum und Foren gibt es auf der Gemeinde-2.0-Homepage zum Nachhören im mp3-Format
- Das Forum "Social Media" am Samstagnachmittag konnte man weitgehend in die Tonne treten. Obwohl damit zu rechnen war, dass Twitterer anwesend sein würden, war nicht für WLAN gesorgt worden. Es folgte zum Auftakt eine Peinlichkeit, als das aus dem Netz abgespielte Einstiegsvideo natürlich hängenblieb und schließlich abgebrochen werden musste. Und die Gesprächsrunde verlor sich dann in halbgarem Gefasel mit wenigen Konkretionen; neue Ideen gab es schon gar nicht (wenn Videoübertragungen in Gottesdiensträume als Social Media verkauft werden, muss ich mich was fragen). Das war enttäuschend.
Aber mit diesem harten Urteil will ich nicht enden, denn insgesamt war die Konferenz durchaus anregend und motivierend. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle mehr "Butter bei die Fische" gewünscht, und lieber ein Seminar mehr, dafür eine Plenumsveranstaltung weniger gehabt. Und: Ich habe mir endlich die beiden "Milieus praktisch"-Bände zugelegt.
Abonnieren
Posts (Atom)